Genderhinweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und zur Vereinfachung des Verständnisses wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern hier die männliche Form verwendet. Wir verstehen das generische Maskulinum als neutrale grammatikalische Ausdrucksweise, die ausdrücklich im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich alle Geschlechter umfasst.
Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.
UNSER LEISTUNGSANGEBOT
Erziehung braucht Beziehung, Beziehung braucht Ordnung und Sicherheit!
Wir setzen uns aktiv für die Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen ein
Das IBO bietet ambulante Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien in schwierigen Lebenslagen
Das IBO unterstützt Familien durch gezielte Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenzen und zur Förderung eines positiven Familienklimas
Wir bieten professionelle Begleitung und Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die in schwierigen familiären Situationen Unterstützung benötigen.
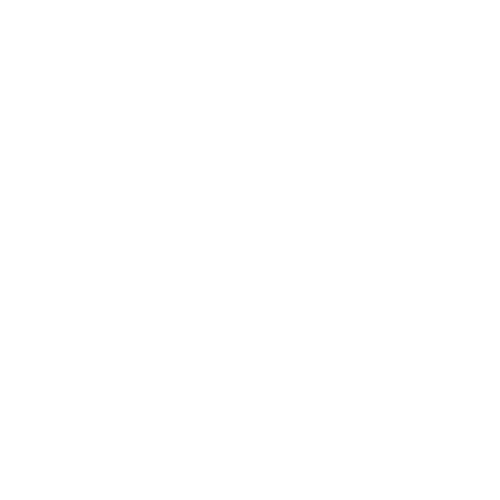
WIR BERATEN UND BEGLEITEN SIE
Innerhalb der ambulanten Jugendhilfe sind wir in den Bereichen Sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistandschaft tätig.
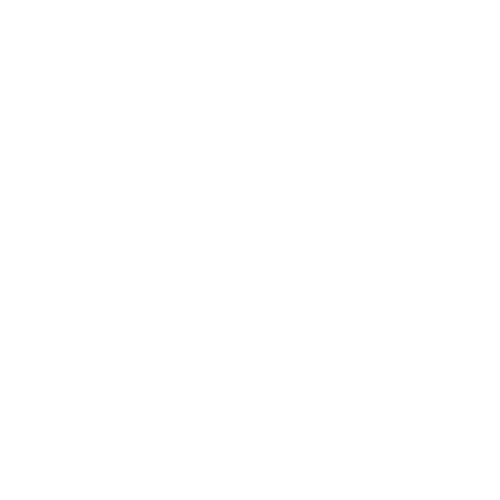
FLEXIBLE & IMPULSGEBENDE HILFEN
Wir orientieren uns am Bedarf der Kinder, Jugendliche und Familien, und entwickeln flexible und impulsgebende Hilfen.
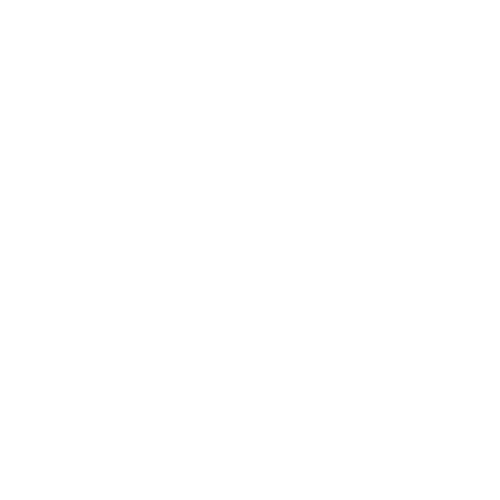
WIR BIETEN IHNEN EINE HOHE QUALITÄT
Die Mitarbeiter von IBO besitzen eine hohe Kompetenz und sehr viel Verantwortungsbewusstsein.
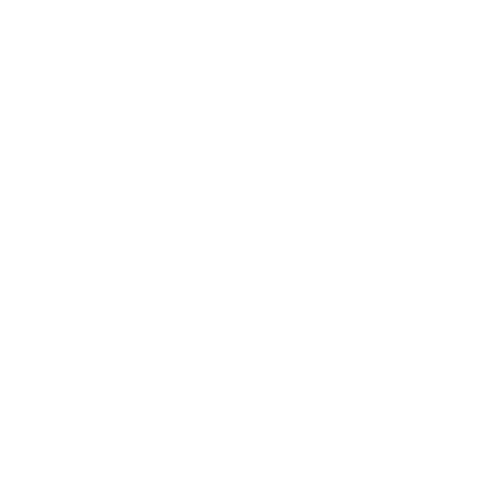
IBO BIETET EINEN PLATZ FÜR JEDEN
Wir stehen Ihnen persönlich zu folgenden Zeiten zur Verfügung:
Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr
IHR INSTITUT FÜR BILDUNGSBERATUNG UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG HAPPERSBERGER
Das Institut für Bildungsberatung und Organisationsentwicklung Happersberger (IBO) widmet sich seit 2009 den Themen Autismus, ADHS und oppositionelles Verhalten in Familien. Wir arbeiten eng mit Schulen, pädagogischen Einrichtungen, dem Jugendamt, anderen Behörden, Institutionen und Fachkräften zusammen, um eine umfassende Unterstützung für betroffene Familien zu gewährleisten.
Das IBO verfügt über umfangreiche Expertise in den genannten Bereichen und setzt sich aktiv dafür ein, das Verständnis und die Unterstützung für Menschen mit Autismus, ADHS und oppositionellem Verhalten zu verbessern.
Wir engagieren uns besonders für eine gute Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit diesen Herausforderungen in Schulen und pädagogischen Einrichtungen.
Wir unterstützen Einrichtungen und Familien bei der Entwicklung individueller Förderpläne und Nachteilsausgleiche und bieten darüber hinaus Schulungen und Beratung für Lehrkräfte und pädagogisches Personal an, um eine angemessene Unterstützung und eine positive Lernumgebung zu schaffen.
WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir neue Mitarbeiter (m/w/d).
Wir suchen für unser Institut neue engagierte Mitarbeiter (m/w/d) ab sofort.
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!
Dich erwartet eine abwechslungsreiche Arbeit
Wir pflegen ein angenehmes Betriebsklima





